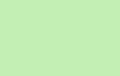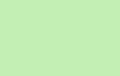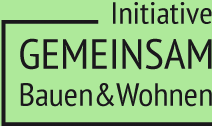Literatur



In: Susanne Heeg und Marit Rosol (Hrsg.): Gebaute Umwelt. Aktuelle stadtpolitische Konflikte in Frankfurt am Main und Offenbach. Unter Mitarbeit von Susanne Heeg und Marit Rosol.

Die Studie widmet sich der Frage, welche Rolle gemeinschaftliche Wohnformen bei einer altersgerechten Quartiersentwicklung spielen können bzw. inwiefern gemeinschaftliche Wohnformen als Instrument für eine altersgerechte Quartiersentwicklung eingesetzt werden können. Als Fallbeispiel dient die Hausgemeinschaft „Gemeinsam statt einsam. Generationswohnen in Arnstadt-Ost“.
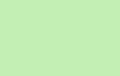
Gemeinsames Interesse: Attraktive Wohnungsbestände, die Mieter langfristig binden, sind ein genuines Interesse der Wohnungswirtschaft. Ältere Menschen wiederum wollen auch bei eingeschränkter Mobilität oder Gesundheit möglichst lange selbstbestimmt in eigenen Räumen leben. Eine aktive, hilfsbereite Nachbarschaft entspricht dem Wunsch nach bedarfsgerechter, individueller Unterstützung in unmittelbarer Nähe. Wohn- und Nachbarschaftskonzepte wie das gemeinschaftliche Wohnen bieten deutliche Mehrwerte für alle Beteiligten, denn im Verbund mit professionellen Dienstleistungen werden tragfähige soziale Netzwerke mobilisiert, die auch bei zunehmender Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit bezahlbar bleiben. Gemeinschaftswohnprojekte decken damit – weit über die rein altersgerechte Bestandssanierung hinaus – soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse ab und schaffen für altersgleiche wie altersgemischte Gemeinschaften neue Lebensqualitäten, wie sie rein professionelle Angebote nicht anbieten können.
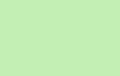

Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Diss., 2012